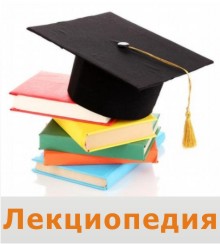
Stilmittel im Rahmen des Satzbaus
Date: 2015-10-07; view: 577.
Nach Bernhard Sowinski
Zum Begriff der Stilmittel und ihrer Werthaltigkeit
Jede Form von Stil beruht auf dem Zusammenwirken charakteristischer Einzelelemente in einem bestimmten Kontext, die einen bestimmten Eindruck hervorrufen. Sie werden als Stilmittel, Stilelemente oder Stilistika bezeichnet.1 Das Erlebnis des Stils als eines einheitlichen Formgepräges rundet sich erst nach dem Erfassen aller Stilistika, es wird jedoch bereits in der Begegnung mit einzelnen Stilmitteln angeregt. Diese besitzen daher jeweils einen eigenen Eindruckswert2, der sich aus dem Verhältnis dieser Elemente zum Textinhalt und zueinander wie zu ihren möglichen oder erwarteten Varianten ergibt. Davon zu unterscheiden ist der Ausdruckswert eines Stilmittels, die Wirkungsabsicht, die der Autor ihm zuschreibt. Eine Wiederholung z.B. kann als Unterstreichung einer bestimmten Aussage gemeint sein (Ausdruckswert) und empfunden werden (Eindruckswert), ein Archaismus als Versuch einer besonderen Bewertung des Gemeinten, eine Umstellung der gewohnten Wortfolge als aufmerksamkeitheischende Verfremdung usw. Doch besitzt auch jedes »nichtabweichende« Ausdruckselement im Zusammenhang mit anderen einen bestimmten Stilwert, eine bestimmte Wirkungsqualität, die man im Gegensatz zu den »außergewöhnlichen« (expressiven) Stilmitteln in Analogie zu grammatischen Gradeinteilungen als nullexpressiv zu bezeichnen pflegt.3
Ausdruckswert, Eindruckswert und Stilwert eines Stilmittels sind also nicht identisch. Der Ausdruckswert und der Eindruckswert beziehen sich (im Sinne des einfachen Kommunikationsmodells) auf die Intentionen von Sender und Empfänger, die im Idealfall identisch sein können, infolge der stilistischen Wirkungseigenschaften der Einzelelemente und der unterschiedlichen Verstehensfähigkeit der Empfänger (aufgrund unterschiedlicher Codes, Erfahrungen und Verstehenshorizonte) mitunter aber differieren. Ausdruckswert und Eindruckswert werden oft gleichgesetzt, vor allem in Fällen werkimmanenter Textinterpretation, in denen der Interpret den subjektiv erlebten Eindruckswert für den stilistischen Ausdruckswert des Textes (die Intention des Autors) hält.4 Die Interpretation steht hier insbesondere bei Texten früherer Zeiten vor zahlreichen Schwierigkeiten, die erst durch eine sorgfältige historische Erforschung der Stilmittel und ihrer Ausdruckswerte verringert werden können. Eine solche Aufgabe ist verhältnismäßig einfach bei den Texten zu lösen, deren Gestaltung nach bestimmten Normen der literarischen Rhetorik erfolgte, wie sie in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit (etwa bis zur Mitte des 18. Jhs.) für die einzelnen Textsorten bzw. Gattungen gültig waren, wird aber dort problematisch, wo die Stilgestaltung allein dem subjektiven Empfinden des Autors unterlag, besonders wenn der Sprachgebrauch des Autors und des Slilbetrachters (Empfängers) in Wortschatz und Syntax nicht mehr übereinstimmen. Auch in solchen Fällen ist es erforderlich, die stilistischen Möglichkeiten des Autors, seiner Zeit und der jeweiligen Literaturgattungen zu erforschen. Allerdings muß dies einzelnen Stilmonographien vorbehalten bleiben.
Der Stilwert5 der einzelnen Stilmittel, d.h. die Festlegung ihrer Stilfärbung, Stilschicht oder jeweiligen Expressivität unterscheidet sich vom sprecherbezogenen »Ausdruckswert« wie vom empfängerbezogenen »Eindruckswert« durch seine Beziehung auf die Gesamtheit und Gesamtwertung eines Textes. Ein Stilmittel besitzt keinen gleichbleibenden funktionalen Wert. Es kann in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedliche Wirkungen ausüben und unterschiedliche Stellenwerte besitzen, die sich stets aus der Stilstruktur eines größeren Ganzen ergeben. Eine Beschreibung der Stilmittel kann daher keine feststehenden Stilwerte aufzeigen, allenfalls bestimmte Erfahrungswerte, wie sie sich mit bestimmten Wortarten oder Redefiguren verbinden. Die Bestimmung der Stilweite kann erst in der Einzelanalyse des Textes vorgenommen werden (vgl. S. 275 ff.). Es ist jedoch für jede Stilgestaltung wie für jede Stilanalyse vorteilhaft, die wichtigsten Stilelemente und ihre Anwendungsbereiche zu erkennen.
In den folgenden Kapiteln suchen wir einen Überblick über die Gesamtheit der Stilmittel der gegenwärtigen deutschen Hochsprache zu geben. Dabei kommen gemäß der zugrunde liegenden selektiven Stilauffassung alle grammatischen und semantisch-lexischen Ausdruckselemente (Sprachzeichen und -zeichenkombinationen) in Frage, die in synonymer und annähernd synonymer Verwendung, also im gleichen Kontext, auftauchen können. Wir beziehen dabei auch die grammatischen Kategorien in diesen Überblick ein, soweit dem Sprecher hierbei unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Stilistische Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Satzbaus
Stilistische Phänomene sind vorwiegend Gegebenheiten des Textes, also satzübergreifender Zusammenhänge. Erst in der Wiederholung solcher Erscheinungen im Textbereich erkennen wir eine bestimmte Stilgestaltung. Wir haben deshalb Überlegungen zum Textbegriff und zur Textgestaltung vorangestellt und werden wiederholt auf diese Probleme zurückkommen. Die größere Texteinheit setzt sich jedoch aus zahlreichen Satzeinheiten zusammen Viele Textstilistika erweisen sich als syntaktische Stilmittel des Satzbereichs. Erst hier werden sie für uns faßbar und beschreibbar. Wir beginnen deshalb unsere Übersicht über die einzelnen Stilmittel mit den stilistischen Variationsmöglichkeiten im Rahmen der Satzgestaltung und lenken dabei unsere Aufmerksamkeit auf Gegenstände, die zu den wichtigsten Objeken der gegenwärtigen Grammatikforschung zählen. Während aber die Grammatiker bedacht sind, die Zahl, Form und Funktionsweise der syntaktischen Regularitäten zu erforschen, auf Grundformen zurückzuführen und in angemessener Strenge und Ausführlichkeit darzustellen, mitunter zu formalisieren, suchen wir gewissermaßen das Gegenteil zu beschreiben, nämlich die Arten und Formen der syntaktischen Ausdrucksvariationen, zu denen auch manche »Irregularitäten« gehören, die bei strenger Normauffassung als »ungrammatisch« gelten könnten6, aber gerade durch ihren ungewöhnlichen Charakter stilistisch wirksam sind. Den Ausführungen zur Satzstilistik wäre vorauszuschicken, was unter einem Satz im folgenden zu verstehen ist. Wir können hier jedoch nicht auf die Unzahl der Satz-Definitionen der Grammatik eingehen7, sondern müssen uns mit zwei vorläufigen Bestimmungen begnügen, der Kennzeichnung des Satzes all eines sprachlichen Gebildes, das in der Regel durch zwei Punkte eingerahmt wird, und seiner Charakterisierung als einer mehr oder gegliederten inhaltlichen Einheit, die durch die Setzung eines Nominalteils und eines ihm zugeordneten Prädikatsteils eine bestimmte Aussagespannung hervorruft und löst.8 Stilistisch ist besonders die zweite Auffassung von Belang.
Wir beginnen zunächst mit der Übersicht über die quantitativen Möglichkeiten des Satzbaus.
Der Satzumfang als stilistisches Mittel
Unsere Darlegungen zur Texttheorie ergaben bereits, daß die Menge der Informationen, die in einem Text vermittelt werden soll, je nach Verwendungszweck, Textsorte, Individual und Funktionalstil, der Situation und anderen Motiven verschieden verteilt werden kann. Die Erfahrung lehrt, daß sich dabei zwar keine einheitlichen Quantitäten des Satzumfangs herausbilden – das würde dem bereits genannten Prinzip der Variation als Meidung der Wiederholung widersprechen –, wohl aber bestimmte Durchschnittswerte, die als charakteristisch für den jeweiligen Stil gelten können. Dieser Durchschnittswert, der nach einer gewissen Menge von Sätzen als syntaktischer Erwartungswert sowohl für den Satzumfang wie für die Typik des Satzbaus genannt werden kann, ist besonders in der statistischen Stilistik zum beliebten Untersuchungsgegenstand geworden, weil derartige Angaben in größerem Maße nur mit Hilfe von elektronischen Rechnern zu ermitteln sind.9
Es ist zwar nicht möglich, für die einzelnen funktional geprägten Texte bestimmte Durchschnittswerte von vornherein festzulegen; es lassen sich aber einzelnen Textsorten bestimmte syntaktische Gestaltungstendenzen zuordnen, wobei sich jedoch individuelle Variationen ergeben. So sind z.B. die Sätze in lyrischen Texten wie in Werbetexten oder in der mündlichen Rede verhältnismäßig kurz und mehr parataktisch gefügt, während wissenschaftliche Texte häufig durch lange und hypotaktisch gefügte Sätze gekennzeichnet sind. Zwischen den beiden Polen des kurzen und des langen Satzes liegt das breite Feld der erzählerischen wie ausführlicher mitteilenden Texte. Im folgenden sollen diese drei syntaktischen Umfangsbereiche näher erläutert werden.
Der kurze Satz
Als kurze Sätze seien hier einfache und erweiterte Sätze bis zu 3-5 einfachen Satzgliedern (z.B. Subjekt-Prädikat-Objekt-einzelne adverbiale Angaben) sowie einfache Satzverbindungen kurzer Sätze und Satzgefüge mit einem kurzen Haupt- und einem Nebensatz gemeint. Für solche Sätze, wie sie vor allem dem Sprachgebrauch von Kindern und einfachen Leuten entsprechen, ist die Beschränkung auf wesentliche Angaben, einfache Beziehungsdaten (Personen, Geschehen, Umstände) und ungewandte Fügungen zwischen den Einzelsätzen charakteristisch. Aufgrund dieser Eigenschaften werden sie in der mündlichen Rede, in schnell überschaubaren Mitteilungen (Boulevardzeitungen)10 und in volkstümlichen Textformen (Märchen, Fabeln, Kalendergeschichten, Sagen, Legenden, Volksliedern) bevorzugt, wo es auf eine schlichte, volksnahe und leichtverständliche Sprache ankommt.
Kurze Sätze sind deshalb auch kennzeichnend für die volkstümliche Spruchweisheit (Sprichwörter, Kalenderregeln, Wetterregeln u.ä.) sowie die ihr nachgebildeten Sentenzen und Epigramme. Hier ist überwiegend das Bemühen um bessere Einprägsamkeit stilbestimmend. Neben einfachen Sätzen werden dabei gern einfache Satzgefüge (mit Relativ- oder Konditionalsätzen und kurzen Reihungen) verwendet:
Eile mit Weile! - Ehe wäg's, dann wag's!
Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten!
Auch andere lehrhafte oder appellierende Texte, wie z.B. Angaben aus Lehrbüchern, Gebrauchsanweisungen, Werbetexten u.ä., bevorzugen kurze Sätze sowie übersichtliche Satzverbindungen und Satzgefüge, z.B.:
Die Antriebfmaschinen sind schutzisoliert (doppelt isoliert).
Das bedeutet für Sie höchste Sicherheit ... (Bedienungsanleitung)
In Werbetexten finden sich häufig erzählerische Passagen in Kurzsätzen, seit eine bestimmte Autofirma diese Form eingeführt hat:
Pst - er schläft.
Kurz vor der Einfahrt in die Autobahn sind ihm die Augen zugefallen. Seit bald zwei Stunden schläft er. Wir haben das Radio abgestellt. Wir haben das Fenster geschlossen. Wir unterhalten uns nur noch leise. Sein Bettchen ist die Polsterbank im VW 1500...11
In der kunstvollen Sprache der Dichtung wird die Satzlänge in unterschiedlicher Weise als Stilmittel genutzt. Da die Umgangsprache kurze Sätze liebt, dominieren sie auch in der Sprache der Dramatik, besonders wenn diese Verhältnisse des einfachen Volkes realistisch zu spiegeln sucht. Individuelle wie ständische Gegensätze können so, außer durch die Unterschiede im Wortschatz, auch in den Satzformen sichtbar gemacht werden.
In der Lyrik dominieren kurze Sätze wegen der besseren Verständlichkeit, Rhythmik und Musikalität. Häufig fallen hier im sogenannten Zeilenstil Satz (Haupt- oder Nebensatz) und Zeile zusammen, besonders in Volksliedern oder volkstümlichen Gedichten:
Es stehen die Stern am Himmel, Da fahr ich still im Wagen,
Es scheint der Mond so hell, Du bist so weit von mir.
Die Toten reiten schnell ... Wohin er mich mag tragen,
Ich bleibe doch bei dir. (Lenore, aus (Eichendorff, »Des Knaben Wunderhorn«) »Der verliebte Reisende«)
Der Gefahr eines allzu abgehackten Zeilenstils begegnen zahlreiche Lyriker durch das Stilmittel des Zeilensprungs (Enjambement), der Weiterführung des Satzes über eine oder mehrere Zeilen, mitunter sogar über das Strophenende hinweg, wobei allerdings zuweilen die Form der kurzen Sätze aufgegeben wird:
Fragst du mich, woher die bange
Liebe mir zu Herzen kam, -
Und warum ich ihr nicht lange
Schon den bittern Stachel nahm? (Mörike, »Frage und Antwort«)
Für die erzählende Dichtung lassen sich – bis auf die genannten volkstümlichen und didaktischen Textsorten – kaum allgemeinverbindliche Angaben zur Satzlänge machen. Satzbau und Satzumfang sind hier wichtige Ausdrucksformen der dichterischen Individual- und Epochenstile. Während in der Erzählliteratur des 17. und frühen 18. Jhs. lange Sätze vorherrschen, gelten im späten 18. und im 19. Jh., z.T. auch im 20. Jh. (bis auf wenige Ausnahmen) Sätze mittlerer Länge als durchschnittlicher Umfang. Es gab jedoch mehrere Versuche, besonders um die Wende vom 19. zum 20. Jh., die Durchschnittsnorm der mittleren Satzlänge durch das Stilideal des kurzen einfachen Satzes (in unverbundener Reihung) zu überwinden. So finden sich betont kurze Sätze in naturalistischer wie impressionistischer Prosa und Lyrik, aber auch in expressionistischen Texten.
Schwer kam es jetzt die Treppe in die Höhe gestapft. Am Geländer hielt es sich. Manchmal polterte es wieder ein paar Stufen zurück. Es schnaufte und prustete. Eine tiefere heisere Baßstimme brummte. Jetzt, endlich kam es schwerfällig über den Flur. Ein dicker Körper war dumpf gegen eine Tür geschlagen ...(A. Holz / J. Schlaf, »Ein Tod«)
Die naturalistischen Kurzsätze entsprechen der wirklichkeitskopierenden Technik des »Sekundenstils«, mit der A. Holz und J. Schlaf die Einzelheiten der Geschehnisse festzuhalten suchten.
Die impressionistischen Kurzsätze, die sich in der Lyrik (Liliencron,Dehmel u.a.) und Prosa dieser literarischen Richtung finden, sind mit ähnlichen Tendenzen in der zeitgenössischen Malerei verglichen worden, die auch der Skizze und der Andeutung bereits Kunstcharakter zusprachen.12 Besonders wirksam war die Anlehnung an die gesprochene Sprache in den »inneren Monologen« der Erzählungen Arthur Schnitzlers, die den Kurzsatz verlangten:
Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnt'! Ich möcht' mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleh'n, aber der frißt mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht stör' ... In welcher Gegend die Schwester von Kopetzky steht? Ob ich sie erkennen möcht'?... (A, Schnitzler, »Leutnant Gustl«)
Eine Übersteigerung der »Kurzsätzigkeit«, die ebenfalls den Gepflogenheiten der mündlichen Rede folgt, ist die Abtrennung unselbständiger Satzglieder durch Punkte vom jeweiligen Haupt- oder Gliedsatz:
Die Wolken rasten über mir hin. In schweren, graublauen Ballen unter einem gelben Dunst. Tief in schleifenden Fetzen... (J. Schlaf, »In Dingsda. Im Wind«)
Die Punkte schaffen hier Pausen und verleihen so den Einzelgliedern größere Gewichtigkeit. In der Sprache der Werbung kehrt diese Abtrennung häufig wieder. Anderer Art sind die Kurzsätze bei einzelnen expressionistischen Autoren. Sie sollen ihr ekstatisches Gefühlserleben spiegeln, das in Einzelwörtern, Satzfetzen und Kurzsätzen gleichsam hervorbricht, wobei sich häufig die geläufige Wortstellung ändert; z.B.:
Ulan: Wo ist hier ein Weg? Der Sand hat mich verschlagen und mein Tier. Nacht bricht herein, eintönig, drohend, mit ungeheurer Weite. Verirrt. Nirgends etwas zu sehen. Himmel verhüllt und Erde eine stumpfe Wand, öde, vom Wind gestoßen. Legen wir uns hin. Auch du sollst ruhen, Tier. (Reinhard Goering, »Kriegerische Feier«)13
Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte der Kurzsatz in den Dichtungen Wolfgang Borcherts zu neuer Geltung. In der Einsilbigkeit der Wörter und der Satzkürze sollte sich die Dissonanz der Weltverhältnisse unmittelbar spiegeln.14 Verbindende Konjunktionen, Gliedsätze, kausale und konditionale Erklärungen als Ausdruck einer beim Sprechen mitwirkenden Reflexion wurden daher gemieden. Fehlende Bezüge sollten durch parataktische Reihung, Wort- und Satzwiederholungen und groteske Bilder suggeriert werden:
Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen den Himmel. Der Mond fehlte, und das Pflaster war erschrocken über den späten Schritt. Dann fand er eine alte Planke. (W. Borchert, »Die drei dunklen Könige«)
Der verhältnismäßig kurze Satz ist am Ende des 19. Jhs. auch von einigen Germanisten als Stilideal vertreten und gepflegt worden. Sie wollten damit der oft unübersichtlichen Periodenbildung wissenschaftlicher Schriften entgegenwirken, wie sie besonders durch einige Philosophen des deutschen Idealismus in Mode gekommen waren. Gleichzeitig wollten sie beweisen, daß auch in kurzen Sätzen wissenschaftliche Informierung möglich war. Besonders Wilhelm Scherer ist hier (neben Hermann Grimm und Oskar Walzel) zu nennen.15 Seine weitverbreitete Literaturgeschichte bietet zahlreiche Beispiele für eine oft epigrammatische Satzkürze, wenn sie auch durch Anaphern, Steigerungen, Fragen, Antithesen u. a. rhetorisch aufgeputzt und aufgelockert erscheint:
Sein Ideal ist die Unschuld. Schönheit definiert er Dämmerung. Mond und Nebelschleier, sanftes Licht und zarte Verhüllung scheinen ihm der höchste Reiz. Dem unwahr Heroischen und gewaltig Tugendhaften, das schon Wieland bekämpfte, zog er das Heitere und Naive vor.
(W. Scherer, »Geschichte d. deutschen Literatur«, 14. Aufl., S. 480)
Der Stilwert kurzer Sätze wird meistens erst im Kontrast zu anderen Satzquantitäten deutlich. Auch W. Scherer kennt den Wechsel zwischen kurzen Sätzen und langen Sätzen, durch den Einsichten nachdrücklich vertieft und gedankliche Spannung besonder hervorgehoben werden können. Zwei Beispiele bedeutender Stilisten mögen dies verdeutlichen:
»Niemand«, sagen die Verfasser der Bibliothek, »wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe.« Ich bin dieser Niemand; ich leugne es geradezu. (G. E. Lessing, »17. Literaturbrief«)
Durch die Geleise ging ein Vibrieren und Summen, ein rhythmisches Geklirr, ein dumpfes Getöse, das, lauter und lauter werdend, zuletzt den Hufschlägen eines heranbrausenden Reitergeschwaders nicht unähnlich war. Ein Keuchen und Brausen schwoll stoßweise fernher durch die Luft. Dann plötzlich zerriß die Stille. Ein rasendes Tosen und Toben erfüllt den Raum, die Geleise bogen sich, die Erde zitterte – ein starker Luftdruck – eine Wolke von Staub, Dampf und Qualm, und das schwarze, schnaubende Ungetüm war vorüber. (G. Hauptmann, "Bahnwärter Thiel«)
In beiden Beispielen besitzen die kurzen Sätze (Ich bin dieser Niemand – Dann plötzlich zerriß die Stille) eine erhöhte Ausdruckskraft. Sie wirken wie unvermittelte Antithesen, die eine neue Situation heraufführen, von der im folgenden Text gesprochen wird.
Trotz derartiger Silwirkungen lassen sich keine allgemeingültigen Regeln über einen grundsätzlichen Wert kurzer Sätze aufstellen, wie dies in manchen Stillehrbüchern geschieht.16 Kurze Sätze allein steigern nicht den Eindruck von Hast und Bewegung, wie gelegentlich behauptet und in der Triviailiteratur oft exemplifiziert wird, längere Sätze allein bewirken noch nicht den Eindruck von Ruhe und Gelassenheit.17 Kurze Sätze unterstreichen vielmehr nur das inhaltlich Vorgegebene, also beispielsweise auch inhaltliche Erzählspannungen, durch die Überschaubarkeit des Gesagten und die Staupausen der Punkte. Längere Sätze häufen die Informationsdaten zwischen den Punkten und wirken so komplexer und reflektierter. Der Autor muß also im einzelnen entscheiden, welche Satzlänge er wählt.
Der Satz mittlerer Lange
Nach dem bereits Gesagten kommt heute dem Satz »mittlerer Länge«, der etwa 4-7 Satzglieder und etwa 10-25 Wörter umfaßt, die größere kommunikative Bedeutung zu.18 Stichproben ergaben, daß ein großer Teil der Pressekommentare und größeren Zeitungsberichte, der Geschäftsbriefe und Beschreibungen, der allgemeinverständlichen wissenschaftlichen Literatur wie auch der Erzählliteratur aus Sätzen dieses Umfangs besteht.19 Hierzu gehören nicht nur einfache erweiterte Sätze, sondern auch nicht zu lange Satzglied- oder Satzreihen sowie nicht zu komplizierte Satzgefüge. Wir schließen hier einige Satzbeispiele dieser Art aus verschiedenen Textsorten an, urn den Umfang dieser mittleren Satzlänge zu verdeutlichen:
Auch die übrige Welt ist sich nicht einig darüber, bei wem die Schuld zu suchen ist. Die einen verdammen Rawalpindi, das erst jahrelang die Brüder in Ostpakistan ausgebeutet hat und dann versuchte, sie brutal und mit Waffengewalt von der Verselbständigung abzuhalten... (Pressebericht)
Mühelos und unter Flüstern und Traumdeuten fanden wir ins erste Kellergeschoß und abermals Stufen hinauf. Die roten Positionslichterchen zeigten den Weg zwischen gestapelten Eisblöcken, den Ausgang, das viereckige Licht. Aber Jenny hielt mich zurück. Keiner sollte uns sehen, denn, »wenn sie uns erwischen«, sagte Jenny, »dürfen wir nie mehr hinein«. (G. Grass, »Hundejahre«)
Die Sätze »mittlerer Länge« sind gut geeignet, alle kommunikativ wie poetisch norwendigen Informationen kombinierter Einzelvorstellungen so zu vereinigen, daß keine gedanklich-inhaltlichen Brüche entstehen. Sowohl temporale als auch kausale, konditionale und andere Beziehungsverhältnisse können in Sätzen dieses Umfangs mit den entsprechenden Hauptsatzaussagen kombiniert werden. Im Gegensatz zu den verhältnismäßig relationsarmen Kurzsätzen sind hier auch attributive Satzgliederweiterungen möglich. Dem geübten Leser bleiben derartige Sätze meistens noch überschaubar, besonders dann, wenn sie in sich mehrfach gegliedert sind. Gliederungsfähigkeit wie Umstellbatkeit der Glieder ermöglichen zahlreiche stilistisch wirksame Satzbauvarianten, so daß der Eindruck stereotyper Satzmusterwiederholungen auch ohne Quantitätsveränderungen vermieden werden kann. Der Wechsel zwischen Sätzen dieses Umfangs mit kürzeren oder längeren Sätzen, wie er in vielen Texten anzutreffen ist, schafft zusätzliche Varianten.
Lange Sätze
Die Bevorzugung langer Sätze, die über die mittlere Länge hinausgehen, hat ebenso wie die häufige Wahl kurzer Sätze als wichtiges Stilcharakteristikum eines Textes zu gelten. Nur wenige Dichter – wir nannten schon Kleist und Thomas Mann – sind als Liebhaber langer Sätze, zumeist kunstvoll gebauter Perioden, bekannt. Der lange Satz – soweit er nicht, wie bei Kleist, zeitlich und räumlich nahe oder zeitgleiche Einzelgeschehnisse und -gedanken im Nacheinander der syntaktischen Abfolge bündelt – ist vorwiegend für gedankliche Reflexionen geeignet. Er findet sich in politischen, philosophischen und spezialwissenschaftlichen Texten, die größere Gedankenkombinationen in Einzelsätzen erfordern. Sofern poetische Texte derlei Satzumfang bevorzugen, handelt es sich fast ausschließlich um Texte auktorial erzählender Autoren, die mit dem Erzählgeschehen ihre eigene Kommentierung darbieten.20Es sind mehrere Formen des langen Satzes üblich: 1) der erweiterte einfache Satz, 2) das erweiterte Satzgefüge (die Periode) mit mehreren Haupt- und Nebensätzen, 3) Sätze mir Reihungen mehrerer Satzglieder oder selbständiger Satze.
Erweiterte Sätze
Bei den erweiterten Sätzen der ersten Form handelt es sich um Auf-schwellungen des einfachen, aus Subjekt und Prädikatsteil bestehenden Satztyps. Bekanntlich kann jeder einfache Satz durch weitere Angaben über die mit einem Geschehen oder einer Handlung verbundenen Umstände, Personen, Aspekte u.dgl. bis zur Grenze der Verständlichkeit und der Klarheit erweitert werden. Neben den verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten der prädikativen Aussage (des verbalen Kerns), den Objekten, Umstandsbestimmungen (adverbialen Angaben), Satzadverbien (Modalwörtern) und Partikeln, deren stilistischen Wert wir an anderer Stelle erläutern (vgl. S. 131f.), kommen hier attributive und adverbiale Erweiterungen der nominalen Glieder in Frage. Derartige Satztypen machen bereits einen Großteil der Sätze von mittlerer Länge aus, tauchen aber auch oft bei den »langen« Sätzen auf. Untersuchungen haben gezeigt, daß solche Erweiterungen einfacher Sätze in den verschiedenen Formen zuzunehmen scheinen, jedenfalls als Signum des heutigen »Zeitstils« angesehen worden können. In besonderern Maße gilt dies für die attributiven Erweiterungen von Substantiven (vgl. S. 127).21
Die sprachliche Leistung solcher erweiterten Sätze besteht in. der Kombination mehrerer satzwertiger Informationen in einem Satz, also in einem engen gedanklichen Zusammenhang. Diese komplexen Aussagen sind heute vor allem in Pressemeldungen, politischen, juristischen und wissenschaftlichen Texten verbreitet, wo es auf eine übersichtliche und zusammenfassende Information sowie auf genaue Angaben und Fest1egungen ankommt, ohne daß diese in Einzelsätzen aufgeführt werden müssen. Z.B.:
Die anhand der Jahrgänge 1933 bis 1944 der Zeitschrift der Deutschen Sprachvereins geschilderte Entwicklung in einem auf seltsame Weise offiziösen Bereich der Kulturpolitik des Dritten Reiches haben wir zunächst nach politischen Ursachen und Wirkungen zu erklären. (P. v. Polenz, „Sprachpurismus...“)22
Für die Anwendung der Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die gerichtliche Zuständigkeit und die Übernahme, Abgabe oder Überweisung der Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung in Strafsachen stehen die in Art. 7 Abs. 1, 2 und 4 genannten Verbrechen und Vergehen den ihnen entsprechenden Verstößen gegen Vorschriften des Strafgesetzbuches gleich.
(StrÄndGes §8)
Besonders beliebt sind attributive Erweiterungen des Subjekts in Anfangsstellung (der sogenannten Normalstellung), vielleicht weil auf diese Weise ein großer Teil der Informationsmenge eines Satzes bereits am Satzanfang vermittelt werden kann und die Satzspannung dadurch nicht allzusehr ausgedehnt wird. Stilistisch sind derartige nominale Konstruktionen nur dannangemessen, wenn sie übersichtlich und verständlich bleiben. Oft empfiehlt es sich, einzelne Attributionen dieser Art durch Gliedsätze zu ersetzen, um eine bessere Akzentuierung des Wichtigen und eine größere Verständlichkeit zu erreichen; z.B.: Die Maßnahmen zum Schutze des Trinkwassers, die gestern von den Polizeibehörden eingeleitet wurden, ... anstelle von: Die von den Polizeibehörden gestern zum Schutze des Trinkwassers eingeleiteten Maßnahmen . . .
Satzgefüge
Damit gelangen wir zum zweiten Typ der langen Sätze, zu den Satzgefügen, den syntaktischen Gebilden aus unabhängigen Hauptsätzen und abhängigen Gliedsätzen. Unser letztes Beispiel erinnert daran, daß bestimmte komplexe Satzaussagen, besonders bei längeren Informationen, nicht ohne Auflösung in Gliedsätze auskommen. Durch eine solche Umwandlung bestimmter Satzglieder in Gliedsätze wächst der Satz zwar im Umfang, gewinnt aber meistens an Übersichtlichkeit, wenn die Zahl und Form der Gliedsätze nicht zu groß wird. Manche Autoren bilden mit Vorliebe lange Satzgefüge, um die Komplexität bestimmter Sachverhalte möglichst angemessen, d.h. unter Angabe der verschiedenster Umstände und Beziehungen, auszudrücken. Die Form des Satzgefüges ermöglicht es jedoch auch, gegebene Aussagen durch Einflechtung weniger wichtigir Gliedsätze zu verzögern oder einzuschränken. Die Variationsmöglichkeiten, auf die wir im einzelnen noch zurückkommen (vgl. S. 143 ff.), können auf diese Weise je nach der Art der Satzgefüge unterschiedliche Stilwirkungen zeitigen. Die bessere syntaktische Gliederung kommt nicht nur dem Verständnis zugute, sie bietet auch bessere Mögllichkeiten zu rhythmischer Gliederung und rhetorischer Spannungssteigerung. Während der erweiterte einfache Satz keine strukturelle Pausengliederung kennt und nur vom verstehenden Sprecher nach den inhaltlich-logischen Einheiten angemessen vorgetragen werden kann, besitzt das Satzgefüge klar erkennbare strukturelle Zäsuren in den Gliedsätzen, die dem lesenden Sprecher das Aufnehmen erleichtern und dem Redenden eine abgewogene Stimmführung ermöglichen. Überschaubare Satzgefüge eignen sich daher besser zum mündlichen Vortrag als wenig gegliederte lange Sätze.
Satzgefüge werden in vorbereiteten wie unvorbereiteten Reden bevorzugt, ebenso wie in allen dichterischen Texten, soweit sie sich nicht auf kürzere einfache Sätze beschränken. Selbst im Drama erweist sich die Verwendung überschaubarer Satzgefüge neben kurzen Sätzen, vorwiegend in den Dialogen, als sinnvoll, weil der Vortrag der rhythmischen Gliederung und sprachmelodischen Variation bedarf. Allerdings verbietet hier die Notwendigkeit leichten Verstehens zumeist Erweiterungen zu langen Sätzen. Um so häufiger finden sie sich dafür in der dichterischen und wissenschaftlichen Prosa. Heinrich von Kleists Sätze z.B. sind dafür bekannt, daß sie die verbale Satzspannung durch mehrere Gliedsatzeinschübe über bestimmte Umstände, die das Geschehen determinieren, bis zum äußersten steigern und durch diese Form des Retardierens zugleich die inhaltliche Spannung erhöhen:
Kohlhaas, dem sich, als er die Treppe vom Schloß niederstieg, die alte von der Gicht geplagte Haushälterin, die dem Junker die Wirtschaft führte, zu Füßen warf, fragte sie, indem er auf der Stufe stehenblieb, wo der Junker Wenzel von Tronka sei; und da sie ihm mit schwacher zitternder Stimme zur Antwort gab, sie glaube, er habe sich in die Kapelle geflüchtet, so rief er zwei Knechte mit Fackeln, ließ in Ermangelung der Schlüssel den Eingang mit Brechstangen und Beilen eröffnen, kehrte Altäre und Bänke um und fand gleichwohl zu seinem grimmigen Schmerz den Junker nicht. (Kleist, »Michael Kohlhaas«)
Während Kleist in seinem Satzgefüge die Verbindung von Informationsfülle und dramatisch-situativer Spannung liebt, bevorzugt Thomas Mann die kommentierende, differenzierende oder auch ironisch aufhebende Erweiterung bestimmter Anfangsaussagen, Wir wählen ein verhältnismäßig einfach strukturiertes Beispiel dieser Satzgestaltung:
Die muntere Großtante hatte den Tischgenossen, also den Vettern, der Lehrerin und Frau Stöhr, ein Abschiedssouper im Restaurant gegeben, eine Schmauserei mit Kaviar, Champagner und Likören, bei der Joachim sich sehr still verhalten, ja, nur einzelnes mit fast tonloser Stimme gesprochen hatte, so daß die Großtante in ihrer Menschenfreundlichkeit ihm Mut zugesprochen und ihn dabei, unter Ausschaltung zivilisierter Sittengesetze, sogar geduzt hatte. (Th. Mann, »Zauberberg«)
Auch manche Autoren der Gegenwart greifen auf längere Satzgefüge zurück, ohne jedoch die stilistischen Traditionen Kleists oder Thomas Manns fortzusetzen. Das längere Satzgefüge bildet oft nur noch eine Art von Stauung im Strom der kürzeren Sätze, häufig auch eine Kumulation mit Aufreihungen verschiedener Art.
Robert wollte nicht zum Flugplatz, aber Riebenlamm hatte ihn gefragt, ob er nun zu allem noch feige sein wolle, und da hatte Robert zum erstenmal gemerkt, daß er nicht nur von Trullesand durchschaut worden war, und er war in den Bus gestiegen und hatte erwartet, daß es ihm gehen werde wie Hagen, der Siegfried erschlagen und dem aufgebahrten Toten die Wunde wieder bluten machte durch seine bloße Gegenwart: »dộ kom der künic Gunthệr dar mit sînem man, und auch der grimme Hagene: dar waere bezzer verlân.« (H. Kant, »Die Aula«)
Scheint das längere Satzgefüge auch der Dichtung (bis auf wenige Autoren) zurückzutreten, so wahrt es in zahlreichen politischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten weiterhin seinen Platz. Die Möglichkeit zum Ausdruck bestimmter gedanklicher Beziehungen, die das Satzgefüge bietet, machen es für wissenschaftliche Darlegungen besonders geeignet. Die Grenzen, die Verständnis-fähigkeit und Überschaubarkeit dem Satz setzen, werden dabei von den einzelnen Autoren recht unterschiedlich beachtet. Insofern zeigt der funktionale Stil wissen-schaftlich-theoretischer Texte auch gewisse Ausprägungen von Personalstil.
In der didaktischen Stilistik wird häufig vor dem Gebrauch längerer Satzgefüge gewarnt.23 Die Gründe für diese Scheu sind historischer wie empirisch-didaktischer Natur. Längere Satzgefüge tauchen erst im 16.Jh. in verstärktem Maße in deutschen Texten auf24, vermutlich unter dem Einfluß des Lateinischen, dessen komplizierte Partizipialkonsruktionen insbesondere von den Humanisten nachgeahmt wurden. Während im Mittelhochdeutschen und Frühneuhochdeutschen vorwiegend parataktische vor- und nachgestellte Nebensätze (meistens ohne Umstellung des Verbs) üblich sind, seltener eingeschobene Nebensätze25, begegnen nun immer häufiger hypotaktische Satzstrukturen mit Nebensätzen verschiedenster Art in verschiedenen Stellungen sowie mit der Endstellung des Verbs im Nebensatz. Die im Mittelhochdeutschen gewahrte Freiheit der Satzgliedstellung weicht dabei mehr und mehr einer Logisierung des Satzbaus.
Die Blütezeit der weitgespannten Satzgefüge, die nach dem griechischen Vorbild als »Perioden« (aus gr. períodos = Um-Weg, Umwendung) genannt werden, ist im 17. Jh. und frühen 18. Jh. zu sehen. Muster und Regelbeispiele für Variationen dieses Satzbaus lieferte die antike Rhetorik mit ihrer Differenzierung zwischen einem ordo naturalis, der »durchschnittlich sprachüblichen Abfolge der Satzteile im Satz«, und einem ordo artificialis, der »nicht sprachüblichen Abfolge der Satzteile«26, wenn auch der auf besondere Aufmerksamkeit mit Hilfe sprachlicher »Verfremdungen« zielende »ordo artificialis« nicht ohne weiteres mit dem Periodenbau antiker wie neuzeitlicher Autoren gleichgesetzt werden kann.
Während die Rhetoriklehrbücher des frühen 18. Jhs. den langen Satz noch uneingeschränkt verteidigen, setzt im späten 18. Jh. bereits eine Gegenbewegung ein. Sowohl Th. G. von Hippel (1741-1796) als auch J. G. Herder (1744-1803) wenden sich gegen die zwar rhetoriscn formvollendeten, aber oft inhaltsschwächeren Satzgefüge, deren Vorbild in den im Lateinunterricht eingeübten Perioden Ciceros gesehen wird. Die von den Verfechtern des längeren Satzgefüges betonte Angemessenheit der syntaktischen Periode gegenüber der Folge und Komplexität der Gedanken27 weist Herder mit folgenden Worten zurück: »In demjenigen Stil aber, der nur vom Gedanken beherrscht wird, kann die allzu complicierte und gelehrte Perioden-Lagerung, der auch auf der gegenwärtigen Stufe der deutschen Sprache viel organisch Hinderliches entgegensteht, fortan kein gültiger Schematismus mehr sein, eben weil sie nichts ist als ein Schematismus.«28
Herder bringt noch ein anderes Argument gegen diese Satzform vor, das auch von anderen Gegnern des Periodensatzes wiederholt wurde: die Andersartigkeit des deutschen Satzes gegenüber dem Satzbau anderer Sprachen. Sie zeigt sich besonders in der Behandlung der Partizipialkonstruktionen und der verkürzten Nebensätze, die im Deutschen weniger häufig und wesentlich umständlicher realisiert werden als beispielsweise im Lateinischen, Französischen, Englischen oder Russischen. Die Versuche deutscher Autoren, informationsreiche Sätze dieser Sprachen in deutschen Perioden nachzubilden, müssen deshalb langatmig und schwerfällig wirken. Wenn nun gar vom Lateinunterricht her der Ehrgeiz bestehe, die Sätze Ciceros nachzuahmen, dessen Stil Theodor Mundt (1808-1861), ein Kritiker der »Periode« im 19. Jh., sogar als einen »Stil der Gesinnungslosigkeit« bezeichnete, als eine »Zungendrescherei der langen und atemlosen Perioden, die aufgeblasene Eitelkeit der Rednerbühne«29, so bedeute dies von vornherein die Gefahr der Schwerfälligkeit, Unübersichtlichkeit und eher nur äußerlichen Satzbauordnung.
Während Herder eine Rückführung der Sätze auf die Grenzen des akustisch und visuell Erfaßbaren sowie einen inhaltlich geprägten Wechsel längerer und kürzerer Sätze empfiehlt und Th. Mundt eine Nachahmung des bewegteren taciteischen Stils mit seinen Ellipsen, Anakoluthen und anderen der mündlichen Sprache nahestehenden Elementen fordert, sehen neuere Stilisten, wie schon erwähnt, in der Meidung der Perioden und der Bevorzugung des kurzen Satzes ein stilistisches Heilmittel. Die Bildung umständlicher Satzgefüge ist im 20. Jh. wohl deshalb zurückgegangen, weil die Teilnahme weiterer Volksschichten (ohne lateinische Stilschulung) an der Schrift- und Lesekultur eine stärkere Einwirkung mündlicher Redestrukturen auf die Schriftsprache begünstigte, und zum anderen, weil geänderte Stilideale in der Dichtersprache seit dem 18. Jh. einen natürlichen Sprachstil bevorzugten. Die nunmehr weniger geläufige Periodenbildung konnte so für darin wenig Geübte zur sprachlichen Falle werden, indem sie leicht zu verunglückten Saizbildungen führte. Die Warnung der neueren didaktischen Stilistik vor längeren Satzgefügen erwächst sowohl aus der Auffassung vom »undeutschen« Charakter der Satzperioden als auch aus der Erfahrung häufigen sprachlichen Versagens; sie verkennt dabei jedoch leicht, daß sich diese Form des langen Satzes in jahrhundertelanger schriftsprachlicher Tradition innerhalb der deutschen Sprache einen Platz als vorzügliches Stilmittel gesichert hat, das bei richtiger Handhabung besondere kommunikative und stilistische Aufgaben erfüllen kann und in der künstlerischen wie wissenschaftlichen Literatur auch erfüllt. Wir werden auf die Bildungsweise solcher Satzgefüge noch gesondert zurückkommen (vgl. S. 147ff.).
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| Satzarten nach der Zieleinstellung des Sprechenden | | | Satz- und Satzgliedreihungen |