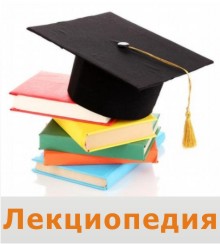
Eigenschaftswort (das Adjektiv)
Date: 2015-10-07; view: 466.
Eigenschaftswort (das Adjektiv) bezeichnet die Besonderheit wie Art, Eigenschaft, Merkmal - von Personen, anderen Wesen, Dingen, gedanklichen Vorstellungen, Tätigkeiten, Vorgängen und Zuständen.
Eigenschaftswörter (das Adjektiv) können wie Hauptwort (Nomina) gebeugt (flektiert) werden, das heißt, sie können nah dem Fall (Kasus), der grammatischen Zahl (Numerus( und dem grammatischen Geschlecht (Genus) unterschiedliche Formen bilden. Im Gegensatz zum Hauptwort haben sie kein festes grammatisches Geschlecht, sondern kommen in allen drei Geschlechtern vor.
Die meisten Eigenschaftswörter sind steigerungsfähig, das heißt, zu den meisten Eingeschaftswörtern können Vergleichsformen gebildet werden. Man unterscheidet drei Stufen:
a/ Grund / Normalstufe (Positiv);
b/ Vergleichsstufe (Komparativ);
c/ Höchststufe (Superlativ).
Je nachdem welche genaue Aufgabe das Eigenschaftswort in einem Satz wahrnimmt und wie es diese Aufgabe wahrnimmt, unterscheidet man drei Gebrauchsweisen:
♥ beifügend (attributiv): die schwere Arbeit
♥ aussagend (prädikativ): Die Arbeit ist schwer.
♥ als Umstandswort (adverbial): Sie arbeiten schwer.
6. Satzarten
Der Satz ist eine relativ selbständige und inhaltlich geschlossene Einheit. Er ist der gesprochene oder geschriebene Ausdruck einer Absicht, Beobachtung, eines Gedankens, Gefühls, Wunsches oder einer Beschreibung von inneren und äußeren Vorgängen. Es gibt verschiedene Satzarten. Jede Satzart beschreibt die entsprechende Absicht des Sprechers. Der Aussagesatz vermittelt dem Leser oder dem Hörer eine Information. Diese Information kann richtig oder fasch sein: Er sagt das Wort. Der Satzbau ist immer derselbe: S (Subjekt) + P (Prädikat) + O (Objekt) (Ergänzung des Ortes, der Zeit, der Art und Weise).
Der Ausrufesatz ist eng verwandt mit dem Aussagesatz. Er bringt neben der Sachinformation auch die innere Bewegung des Sprechers zum Ausdruck:
Das ist eine Überraschung! Ц Ausdruck der Freude.
Darauf habe ich mich so gefreut! Ц Ausdruck der Enttäuschung.
Das Verb kann auch entfallen: Was für eine Überraschung!.
Zu den Ausrufesätzen gehören auch Aufforderungssätze. In Aufforderungssätzen gebraucht man den Imperativ. Der Aufforderungssatz drückt einen Befehl, eine höfliche Bitte oder eine Aufforderung aus. Befehl: Schweig! Lauf! Höfliche Bitte: Zeigen Sie bitte Ihre Ausweis! Aufforderung: Spiel doch ist mir! Das Zeitwort (Verb) steht in der gebeugten Form immer am Anfang des Satzes.
Der Aufforderungssatz hat aber noch weitere Funktionen.
Wunsch: Möge das Kunststück gelingen!
Warnung: Hütet euch vor dem Hund!
Es ermöglicht dem Sprecher, Gefühle verschiedener Art wie z.B. Angst, Ekel, Freude, Schmerz, Sehnsucht, Verachtung, Zärtlichkeit auszudrücken.
Der Fragesatz. Bei einem Fragesatz wird ein Sachverhalt unter einem Aspekt in Frage gestellt. Man unterscheidet zwischen Entscheidungsfragen, Ergänzungsfragen, Vergewisserungsfragen (¬опросы убеждени€) und rhetorischen Fragen.
Die Entscheidungsfrage. Sie fragt nach dem gesamten Inhalt eines Sachverhaltes. Das gebeugte Zeitwort (finiteVerb) steht am Anfang des Satzes: Spielt du morgens mit mir Tennis? Kommt der Mechaniker nächste Woche?
Die erwartete Antwort lautet: Ja / nein oder doch.
Ergänzungsfrage: Sie fragt nach einem Teil des Sachverhaltens unter einem bestimmten Aspekt. Das gebeugte Zeitwort (finite Verb) steht an zweiter Stelle nach dem Fragepronomen (Interrogativpronomen). Wer kann mir die Uhrzeit sagen? Was ist das?
Die Vergewisserungsfrage. Die Vergewisserungsfrage wird dann gestellt, wenn die Richtigkeit einer bereits gegebenen Antwort überprüft werden soll. Die Satzstruktur entspricht dem Aussagesatz, aber entscheidend ist in diesem Fall die Satzmelodie: Du hast die Hausaufgabe gemacht? Er hat seine Prüfung bestanden?
Die rhetorische Frage. Die rhetorische Frage ist keine echte Frage. Der Sprecher erwartet keine Antwort, weil er diese bereits kennt. Hat nicht unsere Partei in all den Jahren vor den Gefahren des Kommunismus gewarnt? Hat sie nicht den Bundesbürger immer wieder vor Blauäugigkeit in der Bewertung der Außenpolitik gewarnt?
7. Der einfache Satz
Der einfache Satz besteht aus zwei Satzgliedern: Satzgegenstand + Satzaussage (Subjekt + Prädikat). Zum Prädikat können auch verschiedene Ergänzungen hinzutreten, was von der Wertigkeit des jeweiligen Zeitwortes (Verbs) abhängt.
Alle einfachen Sätze können eingliedrig oder zweigliedrig sein. Die zweigliedrigen Sätze haben zwei Hauptglieder: das Subjekt und das Prädikat: Er schreibt.
Dazwischen gibt es erweiterte und unerweiterte Sätze: Er schreibt das Diktat.
Die eingliedrigen Sätze haben entweder ein Subjekt oder ein Prädikat. Die Sätze mit dem Subjekt nennt man
Ј substantivische Sätze: Ein Hundertauge im Meer {Netz}; Ein rundes Wässerlein, darüber ein Steglein {Spange};
Ј verbale Sätze: д≥Їсл≥вн≥: Kleiner als Сne Maus | Trägt ein ganzes Haus {Schnecke}; Kannreisen über Wasser und Land | Und spricht verständig, | Hat doch keinen Verstand {Brief}.
Nach dem Inhalt.unterscheidet man:
vollständige: Der Arme rechnet dem Reichen die Großmut niemals als Tugend an;
unvollständige Sätze: Wo arbeitest du? - In der Schule..(Es gibt nicht alle Satzglieder. Aber man kann leicht verstehen, was für ein Satzglied fehlt):
Es gibt auch nicht vollendete Sätze, die man im Affektzustand sagen kann: Unmöglich!
8. Die Satzreihe
Die Satzreihe besteht aus zwei oder mehreren Sätzen, die grammatisch voneinander unabhängig sind: Es klingelte zum dritten Mal, und das Licht erlosch. Die Sätze einer Satzreihe können mit Hilfe von verschiedenen Konjunktionen oder Adverbien miteinander verbunden werden.
Da alle Teilsätze gleichberechtigt nebeneinander geordnet stehen, spricht man von einer Parataxe. Parataktische Verbindung kann mit und ohne Bindewort (Konjunktion) verbunden werden. Bei Satzverbindungen ohne Bindewort spricht man von einer asyndetischen Satzverbindung, werden aber Teilsätze durch Bindewörter miteinander verknüpft, spricht man von einer synthetischen Satzverbindung.
Die asyndetische Satzverbindungen stellen häufig Satzmuster dar, die aus dem Bereich der Rhetorik stammen: Schön ist der Morgen, schön ist der Gesang der Lerche (жаворонок).
Die syndetische Verbindung ist mehr gebräuchlich. Dabei werden verschiedene Arten von Konjunktionen gebraucht: Die Sonne brannte, und eine unerträgliche Hitze brütete über dem Land.
Die Konjunktionen UND, ABER, DENN, ODER wirken nicht auf die Wortfolge im Satz ein: Sie wollen ins Kino, aber alle Karten sind schon ausverkauft.
Die Adverbien DARUM, DESHALB, DESWEGEN, DANN wirken auf die Wortfolge im Satz ein, sie sind zugleich auch Satzglieder, deswegen steht nach diesen Wörtern unmittelbar das Prädikat: Er wohnt hier, darum braucht er kein Taxi.
Wichtig ist auch die Satzverbindung. Eine Satzverbindung stellt die lockere Verknüpfung von zwei oder mehreren Hauptsätzen oder Sätzen gleichen Grades dar.
Es gibt verschiedene Arten der Satzverbindung:
Ј Kopulative oder anreihende Beiordnung (соединительна€ св€зь). auch, außerdem, bald Е bald, besonders, dann, darauf, desgleichen (подобный тому, подобный которому), erstens Е zweitens, gleichfalls (точно также), hierauf (на этом, после того, затем), nachher (потом, затем, впоследствии, позже), nämlich (так как, ибо; а именно Е), nicht allein Е sondern auch, nicht bloß Е sondern auch (мало того, но и ), nicht nur Е sondern auch, noch, sodann (затем, потом), sowie (как только), sowohl Е als auch, teils Е teils, überdies (притом, кроме того), und, weder Е noch, zudem (кроме того, к тому же), zumal (тем более того, что т.к.), zwar (правда, хот€);
Ј Adversative Beiordnung (противопоставительна€ св€зь): aber, allein (исключительно, единственно), dagegen (в сравнении с ними), dennoch (все-таки, однако. тем не менее), dessenungeachtet (несмотр€ на это, тем не менее), doch, entweder Е oder, gleichwohl (все-же, все-таки. однако), hingegen (вопреки, против, напротив), indes (тем временем, между тем), indessen (тем временем, однако, тоже), jedoch (однако, все же), nichtsdestoweniger (тем не менее, несмотр€ на это), nicht Е sondern, oder, sondern, sonst (иначе, в противном случае)), trotzdem, vielmehr (скорее, напротив, более того), wohl (пожалуй), zwar (правда, хот€);
Ј Kausale Beiordnung: denn, ja (тем не менее), nämlich (а именно, тоже).
8. Das Satzgefüge
Unter einem Satzgefüge versteht man die Verknüpfung von einem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebensätzen. Man spricht in diesem Fall von einer Hypotaxe. Das Satzgefüge besteht aus dem Hauptsatz und einem oder mehreren Nebensätzen. Für den Nebensatz ist die Endstellung des Prädikat charakteristisch, und zwar steht das Verbum finitum an der letzten Stelle und der zweiten Teil des Prädikats an der vorletzten Stelle. Die trennbare Vorsilbe wird mit dem Verfinitum zusammengeschrieben. Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, beginnt dieser mit dem Verb finitum: Als wir mit den Reisevorbereitungen fertig waren, machten wir uns auf den Weg.
Es gibt verschiedene Arten von Nebensätzen:
Subjektsätze entsprechen dem Subjekt des Hauptsatzes, antwortet auf die Fragen: wer? was? und wird durch die Konjunktionen dass, ob, wenn oder durch Relativpronomen und Relativadverbien wie, woran usw. eingeleitet: Was du machst, ist für alle interessant.
Objektsätze entsprechen einem Objekt des Satzes und antworten auf dieselben Fragen wie Objekte, d.h. die Fragen der abhängigen Kasus mit oder ohne Präposition: was? wem? wen? wovon? worüber? Die Objektsätze werden sehr oft durch die Konjunktionen dass oder ob eingeleitet: Die Hausfrau fragte, ob uns das Mittagessen geschmeckt hat.
Außerdem werden in Objektsätzen als Bindemittel verschiedene Relativpronomen und Relativadverbien gebraucht: Ich weiß nicht, womit er sich zur Zeit beschäftigt.
Attributsätze entsprechen einem Attribut des Satzes und beantworten die Fragen: welcher? was für in? Sie werden am häufigsten durch die Relativpronomen der, welcher, wer, was eingeleitet: Auf seine Frage, was geschehen war, konnte keiner antworten.
Temporalsätze entsprechen der Adverbialbestimmung der Zeit und beantworten die Fragen: wann? seit wann? bis wann? wie oft? wie lange?. Die Temporalsätze werden durch verschiedene Konjunktionen nachdem, seit, seitdem, sobald, bevor, bis wann, sooft, während, ehe, sowie eingeleitet.
Zwischen dem Haupt- und Nebensatz besteht eine zeitliche Beziehung, die durch die Begriffe Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit und Gleichzeitigkeit ausgedrückt werden. Es geht also um die Frage, ob die Handlung im Nebensatz vor des Hauptsatzes (Vorzeitigkeit), danach (Nachzeitigkeit) oder zur gleichen Zeit (Gleichzeitigkeit) abläuft.
Vorzeitigkeit: Bindewörter (Konjunktionen) Ц nachdem, seit, seitdem, sobald, wenn.
Nachzeitigkeit: Bindewörter (Konjunktionen) Ц bevor, bis, ehe.
Gleichzeitigkeit: Bindewörter (Konjunktionen) Ц indem, indessen, seitdem, sobald, solange, sooft, sowie, während wenn, wie.
Regeln zum Gebrauch der Bindewörter
| Wenn | + | Präsens / Vergangenheit | Wiederholte Handlung |
| Als | + | Vergangenheit | Einmalige Handlung |
| Während / solange | + | Präsens / Vergangenheit | Gleichzeitige Handlung |
| Bevor / ehe | + | Präsens / Vergangenheit | Nachzeitige Handlung |
| Nachdem / sobald | + | Perfekt / Plusquamperfekt | Präsens im Hauptsatz |
| Bis | + | Präsens / Futur | Perfekt im Hauptsatz, zukünftige Handlung |
| Seit / seitdem | + | Präsens | Bis in die Gegenwart dauernde Handlung |
| Seit | + | Vergangenheit | Einmalige Handlung |
Kausalsätze entsprechen der Adverbialbestimmung des Grundes und beantworten die Fragen: warum? weswegen? aus welchem Grunde? Sie werden durch die Konjunktionen da und weil eingeleitet. Da-Sätze sind meistens Vorsätze; weil-Sätze sind meistens Nachsätze.
Reale Komparativsätze entsprechen dem Adverbiale des Vergleiches und beantworten die Fragen: wie? Sie werden durch die Konjunktionen wie, als, je Е desto, je Е um so, je Е nachdem eingeleitet: Je länger ich dies Frau kenne, desto besser gefällt sie mir.
Reale Konditionalsätze geben die Bedingungen an, unter der sich die Handlung des Hauptsatzes vollzieht. Sie beantworten die Fragen: unter welcher Bedingungen? Unter welchen Umständen? Sie werden durch die Konjunktionen wenn, falls eingeleitet: Wenn es morgen nicht regnet, fahren wir aufs Land.
Finalsätze entsprechen dem Adverbiale des Ziels und geben den Zweck der Handlung des Hauptsatzes an. Sie antworten auf die Fragen: wozu? zu welchem Zweck? Und werden durch die Konjunktion damit eingeleitet. Meistens gebraucht man Präsens und Präteritum: Sie gab mir ihre Telefonnummer, damit ich sie anrufen konnte.
Reale Konzessivsätze entsprechen dem konzessiven Adverbiale *обсто€тельство уступки* und geben den Grund an, trotz welchem die Handlung des Hauptsatzes vor sich geht. Sie antworten auf die Fragen trotz welcher Bedingung? Trotz welchen Umständen? und werden durch die Konjunktionen obwohl, obgleich eingeleitet: Obwohl (obgleich) das Wetter schlecht war, fuhr ich aufs Land.
| Adversativsatz (Gegensatz) | Anstatt, dass, während, wohingegen | Ich arbeite wie verrückt, während du faul auf dem Sofa liegst. |
| Finalsatz (Absicht) | Damit, dass, um .. zu | Damit du dich nicht erkältest, solltest du dir etwas Warmes anziehen. |
| Kausalsätze (Grund) | Da, weil, zumal | Die Nachbarin steht gern am Fenster, weil sie sehr neugierig ist. |
| Konditionalsatz (Bedingung) | Falls, sofern, wenn | Sofern du Zeit hast, solltest du dir diesen Film ansehen. |
| Konsekutivsatz (Folge) | So dass, so Е dass, als, dass, ohne Е zu, um Е zu, dermaßen Е dass. | Er war dermaßen betrunken, dass er nicht mehr gehen konnte. |
| Konzessivsatz (Einräumung) | Obgleich; obschon, obwohl, ungeachtet dass, selbst wenn, so .. wie, als, wenn Е auch noch so, je Е desto. | Obgleich er über 80 Jahre ist, unternimmt er jedes Jahr Reisen. |
| Modalsatz (Art und Weise9 | GenausoЕ wie, je Е desto, je Е um so, indem, dadurch Е dass, ohne dass, außer dass, außer wenn, außer ,,, um zu | Indem sie schwieg, vermied sie einen Streit. |
| Relativsatz (Bezug) | Der, die, das, welcher, welche, welches, wer, was, wo | Wenigstens, das du sagst, ist richtig. |
| Temporalsatz (Zeit) | Nachdem, seit, seitdem, sobald, bevor, bis wenn, ehe, sobald, solange, sooft, während, sowie | Bis er die Lage begriff, war der Dieb über alle Berge. |
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| Das Zeitwort (Verb) | | | Definition des Phraseologismus |