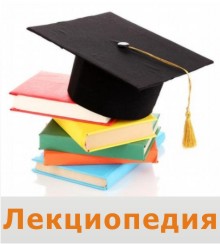
Bedeutung stehender Vergleiche
Date: 2015-10-07; view: 875.
Für die nichtsatzwertigen komparativen Phraseologismen – stehende Vergleiche – ist eine charakterisierende und intensivierende Semantik kennzeichnend, die je nach dem syntaktischen Modell bestimmte zu vergleichende Größen bezeichnen kann:
1) einen hohen / niedrigen Grad des Vorhandenseins einer Eigenschaft
2) Intensität der Handlung
3) Wertung /Abwertung des geschilderten Vorgangs oder Sachverhalts.
So wird in den syntaktischen Modellen – adjektivische und substantivische komparative Phraseologismen – primär ein hoher Grad einer Eigenschaft oder eine Wertung / Abwertung angezeigt, vgl.:
hässlich wie die Nacht (sehr hässlich)
dumm wie die Sünde (außerordentlich dumm)
stumm wie ein Grab (absolut verschwiegen)
ein Gedächtnis haben wie ein Sieb (ein sehr schlechtes Gedächtnis haben)
Für die verbalen Phraseologismen ist primär eine intensivierende und charakterisierende Bedeutung feststellbar, vgl.:
arbeiten wie ein Roboter (ununterbrochen, schwer arbeiten)
schimpfen wie ein Rohrspatz (laut und heftig schimpfen)
schlafen wie ein Sack (tief schlafen)
toben wie ein Berserker (ganz wild, wie ein Wahnsinniger toben)
sich benehmen wie die Axt im Walde (sich ungehobelt benehmen)
Bei den verbalen komparativen Phraseologismen kann die semantische Transformation der Vergleichsgruppe (comparatum) in einigen Bildungen auch eine Präzisierung anzeigen, vgl.: essen wie ein Spatz (sehr wenig essen), essen wie ein Scheunendrescher (viel und gierig essen). Diese Eigenschaft der phraseologischen Bedeutung dieser Subklasse scheint ein universelles semantisches Merkmal zu sein, was zahlreiche spezielle Untersuchungen der komparativen Sprachen bestätigen.
Die stark wertende und intensivierende Semantik des komparativen Phraseologismus entwickelt sich auf Grund der semantischen Transformation der grundlegenden Konstituente dieser Gebilde – des Vergleichs bzw. der Vergleichsgruppe, die aber erst unter Bezug auf die zweite Konstituente eintreten kann. So bekommt z. B. der Vergleich „wie die Nacht“ eine abwertende Bedeutung erst in der Verbindung mit dem Adjektiv hässlich, der Vergleich „wie ein Hund“ bildet, je nachdem mit welcher Konstituente die Phraseologisierung geschieht, eine positive Bedeutung und eine negative, abwertende: treu sein wie ein Hund (sehr treu), leben wie ein Hund (elend, ärmlich leben).
Die semantische Transformation besteht bei diesen Phraseologismen darin, dass der Vergleich bzw. die Vergleichsgruppe in Verbindung mit der in Frage kommenden Konstituente (tertium comparationis) – Adjektiv, Adverb, Verb, Substantiv – eine Bedeutung der Intensität einer Eigenschaft oder eines Geschehens ergibt. Von konkreten und bildlichen Vergleichen individueller Art unterscheidet sich der stehende Vergleich bzw. der komparative Phraseologismus durch eine verallgemeinerte Bedeutung, die darüber hinaus usualisiert ist. Der Unterschied dieser Größen (konkreter individueller Vergleich, bildlicher individueller Vergleich, stehender Vergleich bzw. der komparative Phraseologismus) lässt sich an folgenden Beispielen illustrieren:
a) Karl ist stark wie sein Vater comparandum tertium comparationis comparatum
b) Karl ist stark wie ein Stier comparandum tertium comparationis comparatum
c) Karl ist stark wie ein Bär comparandum tertium comparationis comparatum
Im Beispiel (a) wird das Subjekt (Karl) durch einen konkreten Vergleich charakterisiert, der lediglich feststellt, dass Karl und sein Vater gleich stark sind. Das comparatum als Charakteristik der Eigenschaft stark ist in diesem Fall konkret und individuell.
Im Beispiel (b) wird die Charakteristik des Subjekts mit Hilfe eines bildlichen Vergleichs erzielt. Der Unterschied des comparatum (b) von dem des (a) besteht darin, dass das Lexem Stier nicht konkret, sondern übertragen als Sinnbild der Stärke gemeint ist. Dadurch gewinnt die Charakteristik der Eigenschaft etwas Neues – das comparandum und das comparatum sind in diesem Fall hinsichtlich der Eigenschaft stark (tertium comparationis) nicht gleich charakterisiert, sondern dem comparandum im höchsten Grad zugeschrieben. Infolgedessen gewinnt die auf das Subjekt bezogene Eigenschaft die Bedeutung: „Karl ist sehr stark“. Der Vergleich ist metaphorisch, aber individuell, denn Stier ist im deutschen in einem solchen Gebrauch nicht usualisiert und kann höchstens als eine individuelle Ausformung der Aussage gelten.
Im Beispiel (c) ist das comparatum nicht konkret, sondern übertragen als Sinnbild der starke gebraucht. Zum Unterschied von (b) als Komponente des metaphorischen Vergleichs im Deutschen usualisiert, und in Verbindung stark sein erfolgt die Tranformation des comparatum in eine neue intensivierende Bedeutung. Somit heißt stark (sein) wie ein Bär = «sehr stark sein». Die Tatsache, dass die semantische Transformation erst stattfinden kann, wenn die Vergleichsgruppe auf das tertium comparationis bezogen wird, gibt das Recht, es als den ersten Teil Phraseologismus zu betrachten (den zweiten Teil bildet dann die Vergleichsgruppe). Dementsprechend sind diese Spracheinheiten als zweiteilige Strukturen aufzufassen und somit genauer nicht als stehende Vergleiche, sondern als komparative Phraseologismen zu bezeichnen.
Diskussion
Einige Sprachforscher beschreiben den Phraseologisierungsprozess als Abschwächung der komparativen Semantik infolge der eintretenden verallgemeinerten Bedeutung der zweiteiligen Gesamtstruktur.
Es gibt allerdings eine andere Auffassung, wonach der erste Teil der Verben, Adjektive u.a., mit denen sich die Vergleichsgruppe verbindet, weil sie nicht übertragen sind, als Exoelemente (äußere Elemente) betrachtet werden, die zum Konstituentenbestand des Phraseologismus nicht gehören.
Die Anhänger dieser Auffassung übersehen dabei die Erscheinung der semantischen Bifurkation (Entzweiung, Verzweigung), die darin besteht, dass die Konstituente in der Rede als freies Lexem und als Konstituente des komparativen Phraseologismus gleichzeitig fungiert. Die Folge der beschriebenen Phraseologisierung in den komparativen Strukturen ist eine neue spezialisierte konnotative Bedeutung, die die Festigkeit der komparativen Phraseologismen und ihre Reproduzierbarkeit in Sprache und Rede sichert.
Das Korpus der kodifizierten komparativen Phraseologismen des Deutschen (s. Mizin) offenbart ein zahlenmäßiges Übergewicht der verbalen Spracheinheiten, was wohl mit der alllgemeinen Charakteristik dieser Subklasse (der phraseologischen Einheiten) zusammenhängt. Die Struktur der komparativen Phraseologisrnen und die lexischen Konstituenten, die in diesen Strukturen mitwirken, bilden Voraussetzungen zur Entstehung der Spracheinheiten mit einer bedeutenden konnotativen Wirkung.
Daraus folgt die stilistische Markiertheit der Phraseologismen dieses Typs. Sie sind zum überwiegenden Teil literarisch-umganggssprachlich und salopp, wozu auch häufige Hyperbeln verhelfen, z.B.: „toben wie zehn nackte Wilde im Schnee“, „bleich wie der Tod“. Ursprünglich war wie mit so verbunden (ahd. „so wio“) und ist seit der Verselbeständigung in mhd. Zeit die Vergleichspartikel im verkürzten und stehenden Vergleich bei Gleichheit und Ungleichhheit‚ welche allmählich das ältere als ersetzte. Bei Luther werden beide noch gleicherweise verwendet: seyn angesicht gluehete wie die sonne vnnd seyne kleyder worden weyssals ein hecht» (Wernar Ausg. 6,78).
Vergleichendes als behauptet sich noch länger in Verbindung mit Adjektiven (Adverbien) und vorausgehendem korrelativem so (seit dem l6.Jh.) etwa bei Grimmelshausen: „(ich) schwieg so schtill als ein mauss“ (Simplizissimuss, 1669). Als Musterform im verkürzten Vergleich steht wie in der Verbindung mit als: „als wie ein lamb“ (Paul Gerhart). Wie kann eine persönliche oder sachliche substantivische Große nach Art und Beschaffenheit bestimmen: „reichtum wie der Sand am Meer“ oder z.B. an ein Adjektiv oder Adverb eine Vergleichsgroße anknüpfen: (der Tod ülberfällt uns) „gantz ungestuen wie ein sturme wind“ (H.Sachs, 1530, Keller Goetze, 434). Die sprachwissenschaftliche Fügung gebraucht gern wie mit korrelativem so (seit dem 15.Jh.): wie der Herr so der Knecht. Diese wenigen Angaben zum Gebrauch des vergleichehenden wie nach dem Grimmischen Wörterbuch geben zugleich Anhaltspunkte für die zeitliche Einordnung mancher Vergleiche und Wendungen und ihrer sprachlichen Form.
In sprachwissenschaftlichem Vergleich – den wir ja auch in anderen Sprachen seit alter Zeit finden – bemüht sich der Sprecher um die anschauliche und bedeutungsverdichtende und im Gegensatz zu Gleichnis und Parabel möglichst knapp gefasste Darstellung von Zuständen, Eigenschaften (hell wie die Sonne), Vorgängen und Handlungen (er brüllt wie ein Löwe). Daher entsteht der sprachwissenschaftliche Vergleich in seiner verkürzten, formelhaften Prägung in einem festen Sinnzusammenhang und besteht nicht für sich, wird aber wie dieses, solange Sinn und Satzzusammenhang klar sind, oft über Jahrhunderte hinweg unverändert überliefert. Solche sprachwissenschaftlichen Vergleiche gehen nicht nur auf volkssprachliche Prägungen und allgemeine Beobachtungen zurück, sondern haben oft ihre Quelle in literarischen Vergleichen aus der Bibel, aus den Klassikern, der volkstümlichen Literatur, aus Naturgeschichte und Technik. Umgekehrt sind, aber auch die Vergleiche aus der Umgangssprache in die Literatur eingegangen. Eine eindeutige Unterscheidung von populären Vergleichen von solchen einer literarisch gebildeten Schicht scheint auch der Forschung äusserst fragwürdig. Die meisten sind aber bei aller möglichen Stilisierung in ihrer Treffsicherheit und Bildlichkeit, ihrem Humor und ihrer Ironie feste Bestandteile alltäglicher Umgangssprache, und zwar so sehr, dass sich über ihre Herrkunft und ihr Altersgeist nichts Genaues mehr sagen lasst, man weiß höchstens, dass ein Vergleich wie «bitter wie Galle» bei den verschiedensten Völkern seit der Antike belegt ist.
E.Riesel hebt die Fülle der sprachlichen Assoziationen hervor, die mit Hilfe der Vergleiche entstehen. Sie schreibt: „Wird z.B. von einem Menschen gesagt, dass er wie ein Löwe kämpft, so werden die zwei Substantive Mensch und Löwe (beide in ihrer Grundbedeutung) zueinander in Beziehung gebracht; dies löst eine schnell vorbeiziehende Serie von Einzelbildern aus und erweckt eine neue Vorstellung: mutiger, tapferer Mensch. Obwohl es sich hier um einen gemeinsprachlichen, ja sogar stehenden Vergleich handelt, ist seine Bildkraft doch noch nicht verblasst“ (Riesel, 165).
Neben freien Fügungen (so schnell wie eine Schnecke und wie ein Elefant im Porzellanladen) bestehen solche, die fest mit einem Substantiv oder Verb verbunden sind: Augen wie Mühlräder (sprachwissenschaftliche Übertreibung), er kann schwimmen wie ein Fisch
oder -- witzig das Gegenteil behauptend -- wie eine bleierne Ente.
Adverbiale und adjektivische Vergleiche sind frech wie Oskar oder er ist so dumm wie er lang ist.
Ironischen Vergleiche in ihrer prägnanten Kürze (d.h. Vergleiche vom Typ arm wie eine Kirchenmaus, frech wie Oskar) eignen sich vornehmlich zu einem komischen Kontrast.
Durch eine Art Verfremdungseffekt wird hierbei die komische Wirkung bewerkstelligt, insofern die gewohnte Rededarstellung in eine fremde, schockierend neue Umgebung verpflanzt wird, denn der Vergleich passt nicht, und der Witz liegt dann in dem Unsinn:
klar wie Wurstsuppe (Klossbrühe, dicke Tinte, Torf)
schlank wie eine Tonne
gespannt wie ein alter Regenschirm
ausreißen wie Schafleder
Einfälle haben wie ein altes Haus
gerührt wie Apfelmnuss
frech wie Rotz am Ärmel
passen wie die Faust aufs Auge
verschwiegen wie eine Plakatsäule
er hat es im Griff wie der Bettelmann die Laus.
Ein Ersatz des lexikaschen Elements in der phraseologischen Fügung kann im Dienst von Humor und Satire stehen. So z.B. kann der Ersatz des Wortes Tanne zu Tonne im stehenden Vergleich schlank wie eine Tanne zur Variante schlank wie eine Tonne führen; E.Riesel nennt es „Entstellung“ des stehenden Vergleichs (Riesel, 161), heute betrachtet man solche Änderungen der Phraseologismen als ihre Modifizierungen. Diese Modifizierungen können ihrerseits weiter phraseologisiert werden, es entstehen neue Phraseologismen mit bestimmter stilistischer Färbung.
| <== previous lecture | | | next lecture ==> |
| Definition stehender Vergleiche | | | Thematische Einteilung stehender Vergleiche |